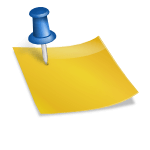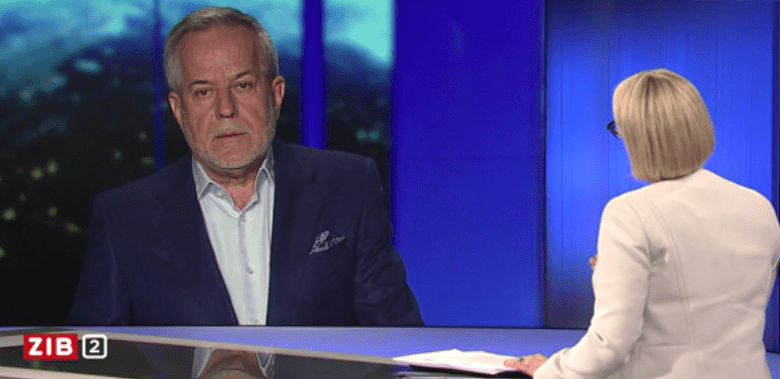Update fürs Parlament
Der Parlamentarismus in Österreich kommt auf der Höhe der Zeit an. Endlich wird in der Geschäftsordnung des Nationalrats verankert, dass die parlamentarische Minderheit – sprich die Opposition – gegen den Willen der Mehrheit einen Untersuchungsausschuss einsetzen kann. Dieser wird damit tatsächlich zum schärfsten Kontrollinstrument der Legislative gegenüber der Exekutive, also der Regierung. Weil diejenigen das Heft in die Hand nehmen können, die auch ein Interesse an Kontrolle haben. Die Oppositionsparteien. Und weil die Regierungsparteien solche Ausschüsse nicht mehr nach Gutdünken abdrehen und missliebige Zeugenladungen verhindern können. Das Parlament kann aber noch mehr. Deshalb sollte es nicht bei diesem Update bleiben.
Die Kontrolle der Regierungsarbeit ist die eine wichtige Funktion des Parlaments, und die wird jetzt so organisiert, wie sie einem modernen und selbstbewussten Verständnis von Parlamentarismus entspricht. Dass SPÖ und ÖVP hier über ihren Schatten springen, auch wenn es dazu vieler Anläufe und gehörigen öffentlichen Drucks bedurft hatte, ist diesen Parteien sehr hoch anzurechnen. Es wird – zweifellos mit einer gewissen Gewöhnungsphase – ein Schritt in die Normalität werden. Wo eben nicht mehr die vielzitierte Show, sondern das verantwortungsvolle Aufarbeiten von Verfehlungen im Vordergrund stehen wird.
Abnicken ist Uralt-Parlamentarismus
Das Parlament hat eine weitere wichtige und zentrale Funktion: Es muss Mehrheiten für Gesetzesinitiativen vor allem der Regierung sichern und auf Grundlage dieser Mehrheiten Beschlüsse fassen. Damit die Politik gestalten kann. Diese Funktion ist so zentral wie unauffällig. Denn in der langen österreichischen Tradition der großen Koalitionen von Rot und Schwarz war die Mehrheit für Beschlüsse immer da – und war die Mehrheit einmal nicht so sicher, dann ist im Vorfeld der parlamentarischen Behandlung alles klar gemacht worden. Die Mehrheit im Parlament hat das Ganze dann nur noch durchgewunken, die Gesetzgebung ist zum Ritual verkommen.
Nicht nur um Zweidrittelmehrheit ringen
Ausnahmen bestätigen diese Regel: Seit Rot und Schwarz über keine gemeinsame Zweidrittelmehrheit mehr verfügen, müssen sie immer wieder um die Zustimmung einer Oppositionspartei ringen – in Frage kommen aufgrund ihrer Stärke die Grünen und die FPÖ, wobei letztere mit ihrer Fundamentalopposition sich da meist selbst im Weg steht und der Regierung selten eine Hilfe ist. Die Grünen sind pragmatischer, was ihnen – Stichwort ESM-Zustimmung – auch schon viel Kritik eingebracht hat.
Bunte Mehrheiten mit Schattenseiten
Es gibt auch ein berühmtes abschreckendes Beispiel für das sogenannte freie Spiel der Kräfte im Parlament. Das war der 24. September 2008, als vier Tage vor der Nationalratswahl mit wechselnden und sehr bunten Mehrheiten milliardenschwere Wahlzuckerln verteilt worden sind – die zum Teil später wieder zurückgenommen werden mussten, weil sie das Budget zu sehr belasteten. Eine Art ausgelassener Jahrmarktstimmung hat in dieser Sondersitzung des Nationalrats geherrscht, und das war wohl darauf zurückzuführen, dass die üblichen Zwänge für einen Tag abgestreift wurden. Plötzlich war so vieles möglich. Und das ist der Punkt.
Koalitionen in den Ländern kein Maßstab
SPÖ und ÖVP könnten nach der Zweidrittelmehrheit ja auch die absolute Mehrheit verlieren und als Zweierkoalition Geschichte sein. Die Frage nach den Alternativen zur ewigen großen Koalition stellt sich dann zwingend, sie stellt sich aber auch, wenn es sich rechnerisch weiterhin ausgehen sollte. Und zwar aus demokratiepolitischen Gründen. Nicht von ungefähr gibt es die Regierungsbeteiligungen der Grünen in sechs Bundesländern – Demokratie lebt vom Wechsel, von der Veränderung. Aber die Länder sind kein Maßstab für den Bund. Hier gehen sich Zweierkoalitionen rechnerisch nicht aus, oder es gibt politische Festlegungen, dass es nicht dazu kommen soll – etwa im Fall von SPÖ und FPÖ. Eine Dreierkoalition etwa von ÖVP, Grünen und NEOS mag für manche vielleicht Charme haben, ist aber ziemlich unrealistisch.
Der Charme der Minderheitsregierung
Bleibt eine Minderheitsregierung, die sich im Parlament immer wieder Mehrheiten suchen muss. Oder positiv formuliert: suchen kann. Dieses Modell funktioniert etwa in skandinavischen Ländern prächtig, bei uns hat es einen schlechten Ruf. Vielleicht weil Bruno Kreisky seine dreizehn Jahre Alleinregierung mit einer Minderheitsregierung begründet hat. Zuletzt hat der damalige Bundespräsident Thomas Klestil im Jänner 2000 in höchster Not eine Minderheitsregierung der SPÖ ins Spiel gebracht, um Schwarz-Blau zu verhindern. Das war viel zu spät und noch dazu so halbherzig, dass der entsprechende Auftrag an den damaligen SPÖ-Vorsitzenden Viktor Klima erst nach mehreren Stunden verständlich wurde. Es bedurfte einer eigenen Aussendung:

Man kann viel gegen eine Minderheitsregierung einwenden, und das tun ja auch viele – vom amtierenden Bundespräsidenten abwärts. Heinz Fischer ist kein großer Freund dieser Regierungsform. Aber das kann bei seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin ab 2016 schon wieder anders aussehen. Wichtig wäre, sich der Chancen bewusst zu werden, die eine Minderheitsregierung für den Parlamentarismus bringen könnte. Und dass sich das Parlament für ein solches Szenario rüstet und dafür sorgt, dass es seine in der Verfassung vorgesehene Budgethoheit auch praktisch wahrnehmen kann. Das Budget ist der Angelpunkt der politischen Arbeit, und im Fall einer Minderheitsregierung müsste das Parlament beim Budget ein entscheidendes Wort mitreden können – und sich nicht nur die Stöße fertiger Vorlagen vom Finanzministerium liefern lassen.
Jetzt nachdenken – nicht erst 2018
Und warum das Ganze jetzt, wo es doch noch vier Jahre bis zum regulären Nationalratswahl-Termin 2018 dauert? Demokratiepolitik ist ein permanenter Prozess, und je näher Wahlen rücken, desto weniger kann man verändern. Die rot-grüne Koalition in Wien liefert gerade den Beweis dafür: Dort wurde eine Reform des extrem mehrheits- sprich SPÖ-freundlichen Wahlrechts vereinbart mit dem Ziel, dass die Sozialdemokraten nicht mehr mit 45 Prozent der Stimmen und ein bisschen was die absolute Mehrheit an Mandaten bekommen. Jetzt steht das Wahljahr bevor und eine Einigung aus, weil eine solche bedeuten würde: Die SPÖ verzichtet freiwillig auf zwei Mandate, noch bevor sie die prognostizierten Verluste bei der Gemeinderatswahl realisiert hat. Der rote Super-GAU.
Häupl, Fellner & der rote Super-GAU
Nicht mit der Wiener SPÖ. Da geht Parteichef und Bürgermeister Michael Häupl lieber in die Offensive und grantelt was von einer “holprigen Ehe” mit den Grünen ins Diktiergerät von Wolfgang Fellner. Und der fragt nicht lange nach, was genau holpert. Es ist das Wahlrecht. Und die Grünen – die der SPÖ machtpolitisch schon viel zu viel durchgehen haben lassen – täten gut daran, hier hart zu bleiben. Jetzt rächt es sich, dass diese Frage auf die lange Bank geschoben worden ist. Aber wahrscheinlich wird es auf Bundesebene genauso laufen: Nur nicht zu weit in die Zukunft schauen – und nach der Wahl werden sich dann wieder alle die Haare raufen.